LIFE FOR BIODIVERSITY
Die Bedeutung des Schutzes von Ökosystemen für die biologische Vielfalt
Die biologische Vielfalt umfasst nicht nur seltene, bedrohte oder gefährdete Arten, sondern alle Lebensformen, vom Menschen bis hin zu uns weniger bekannten Organismen wie Mikroben, Pilzen und Wirbellosen.
Die biologische Vielfalt ist für die meisten Aspekte unseres Lebens wichtig. Sie wird sowohl wegen ihres Nutzens für den Menschen als auch wegen ihres Eigenwertes geschätzt. Zu den utilitaristischen Werten gehören die vielen Grundbedürfnisse, die der Mensch aus der biologischen Vielfalt bezieht, wie Ernährungssicherheit, Widerstandsfähigkeit gegenüber dem Klimawandel, Medizin, Schutz des Menschen und Brennstoffe.
Ökosysteme erbringen wichtige Dienstleistungen wie Bestäubung, Verbreitung von Samen, Regulierung unseres Klimas, Reinigung von Wasser, ordnungsgemäße Rückführung von Nährstoffen und sogar Bekämpfung von Schädlingen, die Nutzpflanzen bedrohen.
Die Erhaltung der Gesundheit von Ökosystemen sichert den Zugang zu Nahrungsmitteln durch die wichtige Rolle von tierischen Bestäubern und anderen wichtigen Ressourcen, wie den Wirkstoffen bestimmter Medikamente, die in Pflanzen und Kräutern enthalten sind. Gesunde und vielfältige Ökosysteme erhalten das natürliche Gleichgewicht, indem sie zur Luft- und Wasserreinigung, zur Klimaregulierung und zum Hochwasserschutz beitragen.
Die biologische Vielfalt bietet auch das Potenzial für die Entdeckung neuer Medikamente und anderer noch unbekannter Leistungen, die der Menschheit zugutekommen könnten.
Die biologische Vielfalt ist für die meisten Aspekte unseres Lebens wichtig. Sie wird sowohl wegen ihres Nutzens für den Menschen als auch wegen ihres Eigenwertes geschätzt. Zu den utilitaristischen Werten gehören die vielen Grundbedürfnisse, die der Mensch aus der biologischen Vielfalt bezieht, wie Ernährungssicherheit, Widerstandsfähigkeit gegenüber dem Klimawandel, Medizin, Schutz des Menschen und Brennstoffe.
Ökosysteme erbringen wichtige Dienstleistungen wie Bestäubung, Verbreitung von Samen, Regulierung unseres Klimas, Reinigung von Wasser, ordnungsgemäße Rückführung von Nährstoffen und sogar Bekämpfung von Schädlingen, die Nutzpflanzen bedrohen.
Die Erhaltung der Gesundheit von Ökosystemen sichert den Zugang zu Nahrungsmitteln durch die wichtige Rolle von tierischen Bestäubern und anderen wichtigen Ressourcen, wie den Wirkstoffen bestimmter Medikamente, die in Pflanzen und Kräutern enthalten sind. Gesunde und vielfältige Ökosysteme erhalten das natürliche Gleichgewicht, indem sie zur Luft- und Wasserreinigung, zur Klimaregulierung und zum Hochwasserschutz beitragen.
Die biologische Vielfalt bietet auch das Potenzial für die Entdeckung neuer Medikamente und anderer noch unbekannter Leistungen, die der Menschheit zugutekommen könnten.
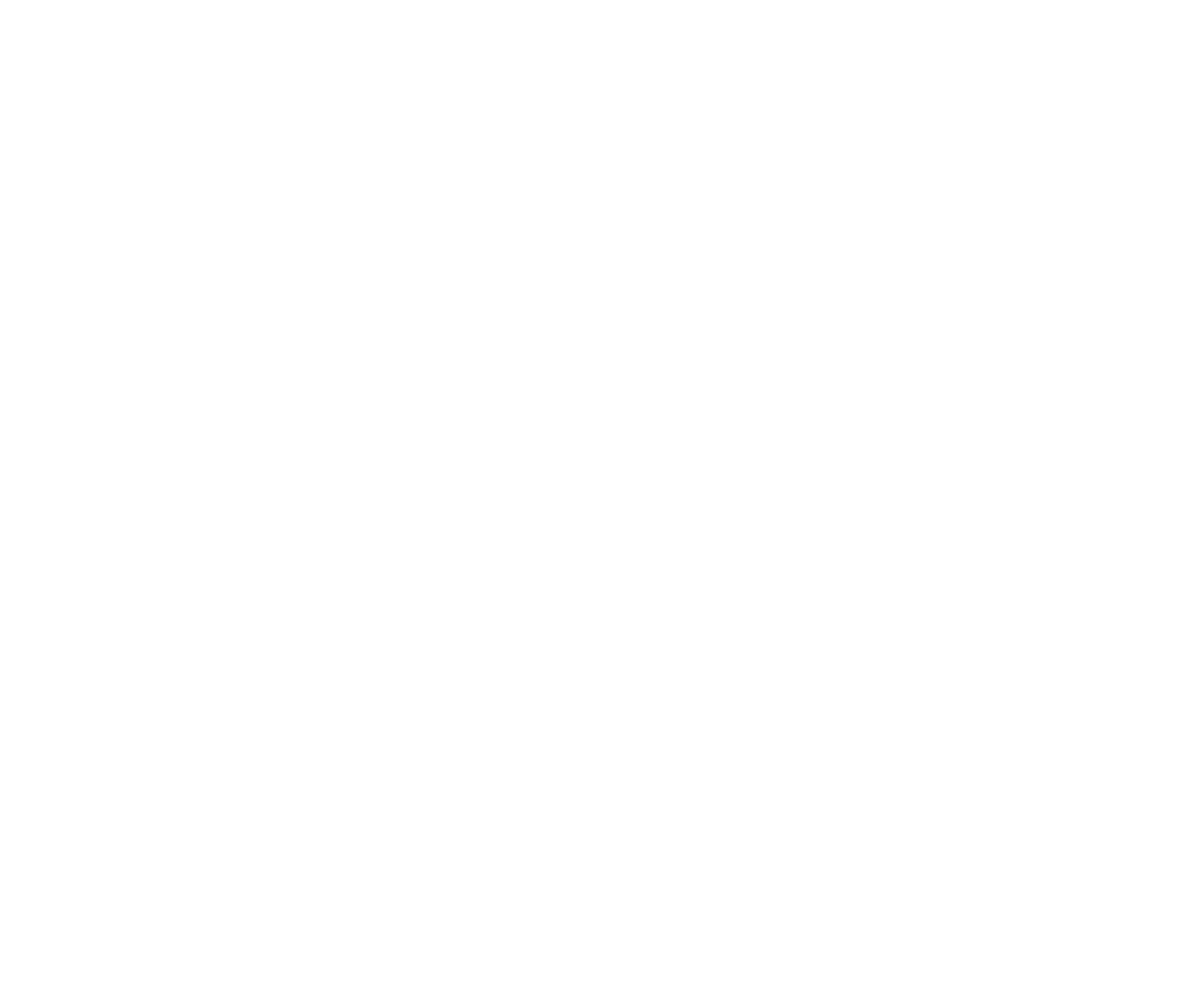
PHENGARIS ARION
Großer blauer Schmetterling
Großer blauer Schmetterling
Die biologische Vielfalt steht durch menschliche Aktivitäten unter zunehmendem Druck, wobei Arten in allen Ökosystemen beispiellosen Bedrohungen ausgesetzt sind. Der Große Blaue (Phengaris arion) ist ein eindrucksvolles Beispiel dafür, wie sich der Verlust und die Fragmentierung von Lebensräumen sowie andere vom Menschen verursachte Veränderungen auf die Tierwelt auswirken. Im Laufe des letzten Jahrhunderts hat die Dominanz des Menschen die Lebensräume umfassend verändert und zu dem geführt, was viele als „Anthropozän” bezeichnen. Der derzeitige Verlust an biologischer Vielfalt bedroht die ökologische Stabilität auf globaler Ebene. Zu den größten direkten Bedrohungen für Arten wie den Großen Blauen gehören die Zerstörung von Lebensräumen, die nicht nachhaltige Nutzung von Ressourcen, invasive Arten, Umweltverschmutzung und der Klimawandel. Die Ursachen dieser Bedrohungen, wie Bevölkerungswachstum und Überkonsum, sind komplex und miteinander verflochten.
Der Große Bläuling ist in hohem Maße von bestimmten Grasland-Ökosystemen abhängig, insbesondere solchen, die durch extensive Landwirtschaft geprägt sind und in denen Wildthymian (Thymus polytrichus) oder Oregano (Origanum vulgare) und die Wirtsameisenart Myrmica sabuleti reichlich vorkommen.
Der Lebenszyklus des Schmetterlings ist einzigartig an diese Bedingungen angepasst und beruht auf einem empfindlichen Gleichgewicht zwischen der Verfügbarkeit von Pflanzen und seiner symbiotischen Beziehung zu den Wirtsameisen.
Der Lebenszyklus des Schmetterlings ist einzigartig an diese Bedingungen angepasst und beruht auf einem empfindlichen Gleichgewicht zwischen der Verfügbarkeit von Pflanzen und seiner symbiotischen Beziehung zu den Wirtsameisen.
Der Große Blaue zeigt eine einzigartige Beziehung zur Ameisenart Myrmica sabuleti, auf die er sich während bestimmter Phasen seines Larven- und Puppenstadiums verlässt.
Diese komplexe ökologische gegenseitige Abhängigkeit unterstreicht die Anfälligkeit des Schmetterlings gegenüber Störungen und Verlusten seines Lebensraums.
Die Schmetterlingslarven betreiben obligate Myrmekophilie, indem sie Ameisen mit einer Mischung aus Zucker und Aminosäuren anlocken, die aus ihren Rückendrüsen abgesondert wird, und die Form von Ameisenlarven imitieren. Diese Beziehung beginnt, wenn die Schmetterlingslarven nach einer ersten Phase der Ernährung auf Wirtspflanzen den Boden erreichen und sich mithilfe ausgefeilter Mimikry in Ameisenkolonien einschleusen.
Diese komplexe ökologische gegenseitige Abhängigkeit unterstreicht die Anfälligkeit des Schmetterlings gegenüber Störungen und Verlusten seines Lebensraums.
Die Schmetterlingslarven betreiben obligate Myrmekophilie, indem sie Ameisen mit einer Mischung aus Zucker und Aminosäuren anlocken, die aus ihren Rückendrüsen abgesondert wird, und die Form von Ameisenlarven imitieren. Diese Beziehung beginnt, wenn die Schmetterlingslarven nach einer ersten Phase der Ernährung auf Wirtspflanzen den Boden erreichen und sich mithilfe ausgefeilter Mimikry in Ameisenkolonien einschleusen.
Sobald sie sich im Ameisennest befindet, frisst die Schmetterlingslarve Ameisenlarven, bis sie sich im folgenden Frühjahr verpuppt. Schmetterlingslarven können während ihrer Entwicklung über 200 Ameisenlarven verzehren, was zu einem Rückgang der Ameisenpopulation führen kann.
SCHUTZSTATUS
Die Art ist aufgrund ihrer speziellen Lebensraumansprüche, Graslandschaften, und der Bedrohung durch Lebensraumzerstörung und -verlust von erheblicher Bedeutung für den Naturschutz.
Der Rückgang des Großen Blauen wird in erster Linie auf den Verlust und die Zerstörung seines Lebensraums zurückgeführt, verursacht durch:
Der Rückgang des Großen Blauen wird in erster Linie auf den Verlust und die Zerstörung seines Lebensraums zurückgeführt, verursacht durch:
Intensivierung der Landwirtschaft, die die Vielfalt und den Bestand von Wildblumen wie Wildem Thymian verringert und sich negativ auf die Nistplätze von Myrmica sabuleti auswirkt.
Veränderungen in der Landnutzung wie Urbanisierung oder Aufforstung, die die für das Überleben der Schmetterlinge wichtigen offenen Graslandökosysteme fragmentieren oder zerstören.
Aufgabe traditioneller Landbewirtschaftungspraktiken wie extensive Beweidung oder Mähen, was zu einer Überwucherung der Vegetation führt, darunter Sträucher (Rosa canina, Prunus spinosa, Rubus fruticosus) und hohes Gras, wodurch Lebensräume sowohl für Wirtspflanzen als auch für Ameisen ungeeignet werden.
Der Klimawandel bedroht die biologische Vielfalt, indem er Ökosysteme und die von ihnen erbrachten Leistungen stört.
Steigende Temperaturen, veränderte Niederschlagsmuster und häufigere extreme Wetterereignisse verschlechtern Lebensräume, verändern die Verbreitung von Arten und stören Lebenszyklen wie Fortpflanzung und Migration.
Aquatische Lebensräume wie Feuchtgebiete, Teiche und Tümpel sind besonders anfällig für Klima- und Landnutzungsänderungen. Sie sind für die biologische Vielfalt und die Wasserregulierung von entscheidender Bedeutung und bieten Amphibien einen wichtigen Rückzugsort. Die Verschlechterung dieser Lebensräume verringert die Wasserrückhaltung und erhöht das Risiko von Dürren, Überschwemmungen und dem Rückgang wasserabhängiger Arten.
Der Erhalt von Ökosystemen ist für die Erhaltung der biologischen Vielfalt unerlässlich, da gesunde Ökosysteme eine Vielzahl von Arten beherbergen und wichtige Funktionen wie Luft-, Wasser- und Bodenreinigung, Klimaregulierung, Bestäubung und Ernährungssicherheit erfüllen.
Die biologische Vielfalt ist nicht nur für seltene oder gefährdete Arten von entscheidender Bedeutung, sondern auch für die täglichen Bedürfnisse des Menschen, da sie Medizin, Brennstoffe und Widerstandsfähigkeit gegenüber Umweltveränderungen liefert.
Steigende Temperaturen, veränderte Niederschlagsmuster und häufigere extreme Wetterereignisse verschlechtern Lebensräume, verändern die Verbreitung von Arten und stören Lebenszyklen wie Fortpflanzung und Migration.
Aquatische Lebensräume wie Feuchtgebiete, Teiche und Tümpel sind besonders anfällig für Klima- und Landnutzungsänderungen. Sie sind für die biologische Vielfalt und die Wasserregulierung von entscheidender Bedeutung und bieten Amphibien einen wichtigen Rückzugsort. Die Verschlechterung dieser Lebensräume verringert die Wasserrückhaltung und erhöht das Risiko von Dürren, Überschwemmungen und dem Rückgang wasserabhängiger Arten.
Der Erhalt von Ökosystemen ist für die Erhaltung der biologischen Vielfalt unerlässlich, da gesunde Ökosysteme eine Vielzahl von Arten beherbergen und wichtige Funktionen wie Luft-, Wasser- und Bodenreinigung, Klimaregulierung, Bestäubung und Ernährungssicherheit erfüllen.
Die biologische Vielfalt ist nicht nur für seltene oder gefährdete Arten von entscheidender Bedeutung, sondern auch für die täglichen Bedürfnisse des Menschen, da sie Medizin, Brennstoffe und Widerstandsfähigkeit gegenüber Umweltveränderungen liefert.
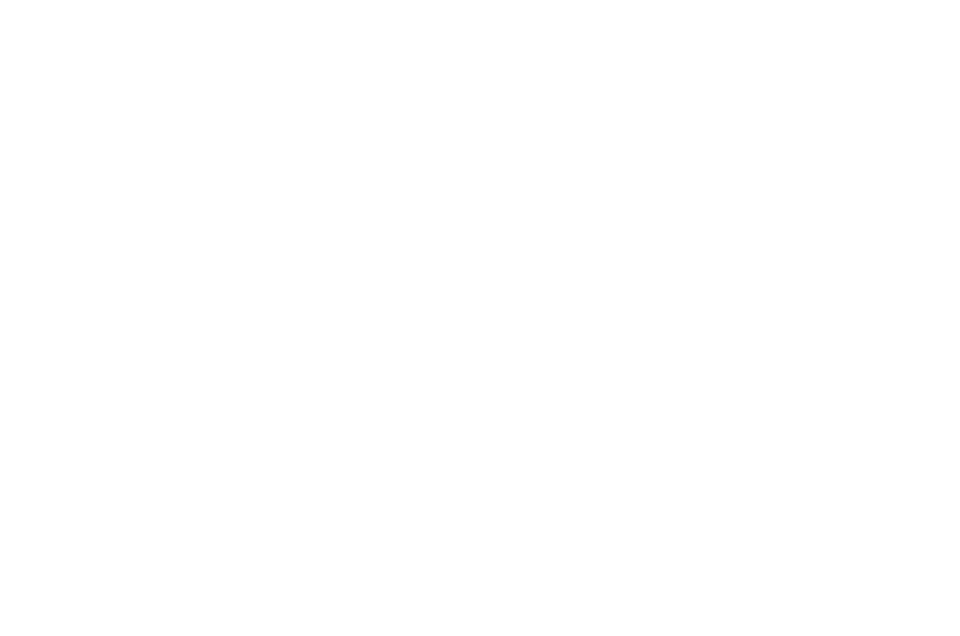
BUFO BUFO
GEMEINE KRÖTE
GEMEINE KRÖTE
Amphibien, darunter Frösche, Molche und Salamander, spielen in zahlreichen Ökosystemen eine entscheidende Rolle. Der Rückgang der Bufo bufo-Populationen ist in erster Linie auf den Verlust geeigneter Lebensräume für die Fortpflanzung der adulten Tiere und die Entwicklung der Larven zurückzuführen. Kleine, periodisch oder dauerhaft vorhandene Tümpel, Feuchtgebiete und Viatelmas sind für Amphibien lebenswichtig. Diese Lebensräume sind ein wesentlicher Bestandteil unserer Fauna und Flora.
Der Klimawandel, der durch schwere Dürren und steigende Temperaturen gekennzeichnet ist, verschärft die Austrocknung und die Stoffwechselveränderungen der Erdkröte.
Menschliche Aktivitäten wie Stadtentwicklung, intensive Landwirtschaft, Landschaftsveränderungen und Veränderungen des Wasserhaushalts führen zu einer Störung des Lebensraums und stellen eine Bedrohung für die Krötenpopulation dar.
Der Klimawandel, der durch schwere Dürren und steigende Temperaturen gekennzeichnet ist, verschärft die Austrocknung und die Stoffwechselveränderungen der Erdkröte.
Menschliche Aktivitäten wie Stadtentwicklung, intensive Landwirtschaft, Landschaftsveränderungen und Veränderungen des Wasserhaushalts führen zu einer Störung des Lebensraums und stellen eine Bedrohung für die Krötenpopulation dar.
Bufo bufo, die Erdkröte, ist eine Art, die in ihren verschiedenen Lebensphasen spezifische Lebensräume benötigt. Für die Fortpflanzung benötigt sie aquatische Lebensräume wie Tümpel und Feuchtgebiete, in denen sich die Larven entwickeln.
Außerhalb der Fortpflanzungszeit bewohnen erwachsene Kröten terrestrische Gebiete, die reich an Insekten, Wirbellosen und kleineren Wirbeltieren sind. Außerdem suchen sie unter Steinen, Baumstämmen oder Laubstreu Schutz für die Winterruhe.
Steigende Temperaturen und anhaltende Dürren erhöhen den Wasserverlust in den Brutgebieten und stören den Stoffwechsel und den Fortpflanzungserfolg der Kröten.
Neben dem Verlust ihres Lebensraums verringern Veränderungen im Wasserhaushalt und in der Landnutzung die Verfügbarkeit geeigneter Schutzräume und Nahrungsquellen.
Außerhalb der Fortpflanzungszeit bewohnen erwachsene Kröten terrestrische Gebiete, die reich an Insekten, Wirbellosen und kleineren Wirbeltieren sind. Außerdem suchen sie unter Steinen, Baumstämmen oder Laubstreu Schutz für die Winterruhe.
Steigende Temperaturen und anhaltende Dürren erhöhen den Wasserverlust in den Brutgebieten und stören den Stoffwechsel und den Fortpflanzungserfolg der Kröten.
Neben dem Verlust ihres Lebensraums verringern Veränderungen im Wasserhaushalt und in der Landnutzung die Verfügbarkeit geeigneter Schutzräume und Nahrungsquellen.
Bufo bufo, die Erdkröte, spielt eine entscheidende Rolle für die Aufrechterhaltung des Gleichgewichts im Ökosystem und dient als wichtiger Bioindikator. Ihre ökologische Bedeutung wird durch ihre Beteiligung an interspezifischen Beziehungen sowie durch die Fortpflanzungsstrategie der Erdkröte unterstrichen: Sie legt ihre Eier in geleeartigen Hüllen ab, die sie vor Austrocknung, Krankheitserregern und Fressfeinden schützen.
Darüber hinaus trägt die dunkle Sekretion, die die Eier umgibt, dazu bei, sie zu erwärmen und ihre Entwicklung zu beschleunigen.
Kaulquappen ernähren sich von Algen und kleinen Tieren und tragen so zur Reinigung aquatischer Lebensräume bei.
Darüber hinaus trägt die dunkle Sekretion, die die Eier umgibt, dazu bei, sie zu erwärmen und ihre Entwicklung zu beschleunigen.
Kaulquappen ernähren sich von Algen und kleinen Tieren und tragen so zur Reinigung aquatischer Lebensräume bei.
Bufo bufo, die Erdkröte, ernährt sich von Insekten, Regenwürmern, Schnecken und verschiedenen anderen Wirbellosen und jagt gelegentlich auch kleine Nagetiere. Im Gegenzug wird sie selbst zur Beute von Raubtieren wie dem Flussotter (Lutra lutra), dem Mäusebussard (Buteo buteo), dem Virginia-Uhu (Bubo bubo) und dem Weißstorch (Ciconia ciconia).
Die Erdkröte dient als Wirt für Parasiten, darunter die Fliege Lucilia bufonivora, deren Larven ihr Gewebe fressen.
Die Erdkröte dient als Wirt für Parasiten, darunter die Fliege Lucilia bufonivora, deren Larven ihr Gewebe fressen.
SCHUTZSTATUS
Die Erdkröte ist aus verschiedenen Gründen in der gesamten EU geschützt. Zu den Hauptfaktoren, die ihre Population gefährden, gehören
LANDSCHAFTSFRAGMENTIERUNG
Straßen und Bebauung machen es Kröten unmöglich, zwischen Lebensräumen zu wandern, und verringern die genetische Vielfalt (je größer die genetischen Unterschiede, desto widerstandsfähiger ist die Population gegenüber Krankheiten und Klimawandel).
TEMPERATUR
Entwicklung und Entwaldung tragen zu erhöhten Temperaturen in der Umwelt bei. Die Temperatur beeinflusst den Stoffwechsel von Kaulquappen und verändert die Aktivität von Insekten, die als Nahrung für erwachsene Kröten dienen.
LANDWIRTSCHAFTLICHE UND FISCHEREILICHE TÄTIGKEITEN
Intensive landwirtschaftliche Praktiken und schlechte Bewirtschaftung (übermäßige Fischfütterung, Einsatz von Pestiziden, Verschmutzung der Gewässer) tragen zum Rückgang der Erdkröte bei.
WASSERLEBENSRAUME
Die Erdkröte benötigt, ähnlich wie andere Amphibienarten wie der Grasfrosch (Rana temporaria) und der Teichsalamander (Salamandra salamandra), aquatische Lebensräume für die Entwicklung ihrer Larven.
Krankheitserreger
Die Erdkröte ist durch Krankheitserreger wie Chytridiomykose bedroht. Dieser Erreger befällt die Haut und beeinträchtigt die Atmung und Wasseraufnahme. Chytridiomykose ist ein wesentlicher Faktor für den weltweiten Rückgang der Amphibienpopulationen.
