LIFE FOR BIODIVERSITY
Beweise für den Klimawandel
„Europas kontrastreicher Sommer Der Sommer 2023 war nicht der wärmste seit Beginn der Aufzeichnungen, aber es gab zeitweise extreme Wetterbedingungen. Es gab Temperatur- und Niederschlagskontraste auf dem gesamten Kontinent und von einem Monat zum nächsten. Der „verlängerte Sommer” (Juni bis September) war geprägt von Hitzewellen, Waldbränden, Dürren und Überschwemmungen. Nordwesteuropa erlebte den wärmsten Juni seit Beginn der Aufzeichnungen, während die Mittelmeerregion weit überdurchschnittliche Niederschlagsmengen für diesen Monat verzeichnete. Im Juli kehrte sich dieses Muster fast um.
Im August herrschten in Südeuropa überdurchschnittlich warme Temperaturen, und der September war der wärmste seit Beginn der Aufzeichnungen für Europa insgesamt. Sowohl im August als auch im September kam es zu schweren Überschwemmungen (siehe S. 12). Ein Großteil Europas war während des verlängerten Sommers von Hitzewellen mit hohen Tag- und Nachttemperaturen betroffen.
Auf dem Höhepunkt der Hitzewelle im Juli waren 41 % Südeuropas von mindestens „starker Hitzebelastung” betroffen, die potenzielle Auswirkungen auf die Gesundheit hatte. Bis Ende August kam es in weiten Teilen Südeuropas, insbesondere auf der Iberischen Halbinsel, zu Niederschlagsdefiziten, die zu Dürren führten. Bis Ende September hatte sich der größte Teil der Iberischen Halbinsel erholt, aber Teile Osteuropas gerieten in eine extreme Dürre. Auch Waldbrände wurden in ganz Europa beobachtet, die meist mit Dürren zusammenfielen.
Im August herrschten in Südeuropa überdurchschnittlich warme Temperaturen, und der September war der wärmste seit Beginn der Aufzeichnungen für Europa insgesamt. Sowohl im August als auch im September kam es zu schweren Überschwemmungen (siehe S. 12). Ein Großteil Europas war während des verlängerten Sommers von Hitzewellen mit hohen Tag- und Nachttemperaturen betroffen.
Auf dem Höhepunkt der Hitzewelle im Juli waren 41 % Südeuropas von mindestens „starker Hitzebelastung” betroffen, die potenzielle Auswirkungen auf die Gesundheit hatte. Bis Ende August kam es in weiten Teilen Südeuropas, insbesondere auf der Iberischen Halbinsel, zu Niederschlagsdefiziten, die zu Dürren führten. Bis Ende September hatte sich der größte Teil der Iberischen Halbinsel erholt, aber Teile Osteuropas gerieten in eine extreme Dürre. Auch Waldbrände wurden in ganz Europa beobachtet, die meist mit Dürren zusammenfielen.
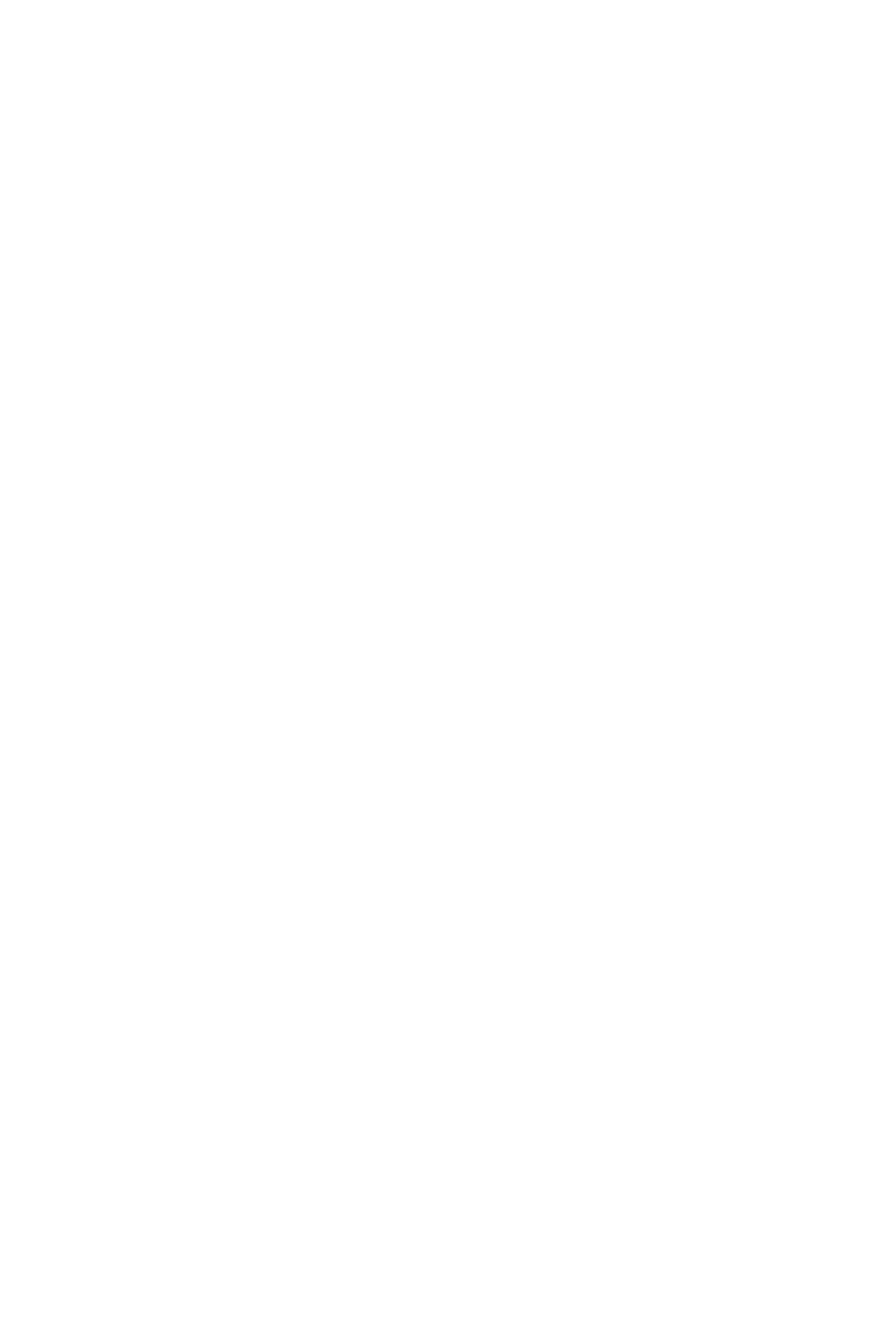
Zitronenbäume
Zitronenbäume gedeihen in milden Klimazonen mit kargen, gut durchlässigen Böden, reagieren jedoch sehr empfindlich auf Kälte und Salzgehalt. Apfelbäume benötigen ausgeprägte Jahreszeiten und kieselhaltige Böden mit kalten Wintern und sonnigen Sommern. Quitten bevorzugen milde Klimazonen, lockere, kühle und feuchte Böden. Mispeln sind winterhart, kälteresistent und passen sich verschiedenen Böden an. Jede Art ist von bestimmten Umweltbedingungen wie Klima, Bodentyp, Wasserverfügbarkeit und Lichteinstrahlung abhängig.
Obstbäume wie Zitronen-, Apfel-, Quitten- und Mispelbäume sind auf wichtige symbiotische Beziehungen mit Bienen, Ameisen und Pilzen angewiesen. Bienen sind unverzichtbare Bestäuber, die Nektar sammeln und gleichzeitig Blumen befruchten, was sowohl die Fruchtproduktion als auch die Erntequalität verbessert. Zitronen- und Apfelbäume sind aufgrund ihrer duftenden, nektarreichen Blüten, die Bienen anziehen, besonders stark von Bienen abhängig.
Ameisen verteidigen Obstbäume möglicherweise vor Pflanzenfressern im Austausch gegen Nektar oder zuckerhaltige Substanzen, aber einige Arten züchten Blattläuse, die den Pflanzen schaden. Pilze können nützlich sein, indem sie Mykorrhiza-Verbindungen mit Wurzeln bilden, die die Nährstoffaufnahme und Widerstandsfähigkeit verbessern. Einige Pilze sind jedoch schädlich und verursachen Krankheiten wie Mehltau und Wurzelfäule.
SCHUTZSTATUS
Bei Zitronenbäumen sind die Hauptprobleme die extreme Kälteempfindlichkeit und die geringe Toleranz gegenüber salzhaltigen Böden, wobei Küstenanbaugebiete besonders anfällig für Salzwassereintritt sind. Apfelbäume leiden unter gestörten Ruhephasen aufgrund wärmerer Winter und einer erhöhten Anfälligkeit für Spätfröste, die die Blüten schädigen. Quitten und Mispeln zeigen eine größere Widerstandsfähigkeit, leiden jedoch dennoch unter der Fragmentierung ihres Lebensraums und sich verändernden Niederschlagsmustern.
Rückgang der Bestäuberpopulationen
Bodenverschlechterung durch extreme Wetterbedingungen
Wasserstress während Dürreperioden
Genetische Erosion traditioneller Sorten
Der Klimawandel hat die durchschnittliche Wassertemperatur von Flüssen und Seen erhöht und die Dauer der Eisperioden verkürzt. Diese Veränderungen haben zusammen mit dem Anstieg der Flussabflüsse im Winter und ihrem Rückgang im Sommer erhebliche Auswirkungen auf die Wasserqualität und die Süßwasserökosysteme. Einige der durch den Klimawandel ausgelösten Veränderungen verschärfen andere Belastungen für aquatische Lebensräume, darunter auch die Verschmutzung. So führt beispielsweise ein geringerer Flussabfluss aufgrund geringerer Niederschläge zu einer höheren Schadstoffkonzentration, da die Verschmutzung weniger verdünnt wird.
Einige Studien zeigen, dass die Teiche der Erde eine größere Artenvielfalt beherbergen als Flüsse und Seen und eine größere Anzahl seltener und bedrohter Arten beherbergen. Viele Wasserpflanzen und -tiere sind für ihr Überleben oder ihre Fortpflanzung vollständig von diesen Lebensräumen abhängig. Diese Gewässer bieten auch zahlreichen Landlebewesen Nahrung und Zuflucht.
„In Europa gibt es Millionen von Teichen, die reich an biologischer Vielfalt sind und eine Vielzahl seltener und gefährdeter Pflanzen und Tiere beherbergen. Sie bieten eine Reihe von Ökosystemleistungen, was im Zusammenhang mit dem Klimawandel besonders wichtig ist. Diese Gewässer sind auch für die europäische Kultur und Geschichte von Bedeutung und stellen eine der engsten Verbindungen zwischen Mensch und Tierwelt dar.“
https://www.europeanponds.org/wp-content/uploads/2014/12/EPCN-manifesto_english.pdf
Einige Studien zeigen, dass die Teiche der Erde eine größere Artenvielfalt beherbergen als Flüsse und Seen und eine größere Anzahl seltener und bedrohter Arten beherbergen. Viele Wasserpflanzen und -tiere sind für ihr Überleben oder ihre Fortpflanzung vollständig von diesen Lebensräumen abhängig. Diese Gewässer bieten auch zahlreichen Landlebewesen Nahrung und Zuflucht.
„In Europa gibt es Millionen von Teichen, die reich an biologischer Vielfalt sind und eine Vielzahl seltener und gefährdeter Pflanzen und Tiere beherbergen. Sie bieten eine Reihe von Ökosystemleistungen, was im Zusammenhang mit dem Klimawandel besonders wichtig ist. Diese Gewässer sind auch für die europäische Kultur und Geschichte von Bedeutung und stellen eine der engsten Verbindungen zwischen Mensch und Tierwelt dar.“
https://www.europeanponds.org/wp-content/uploads/2014/12/EPCN-manifesto_english.pdf
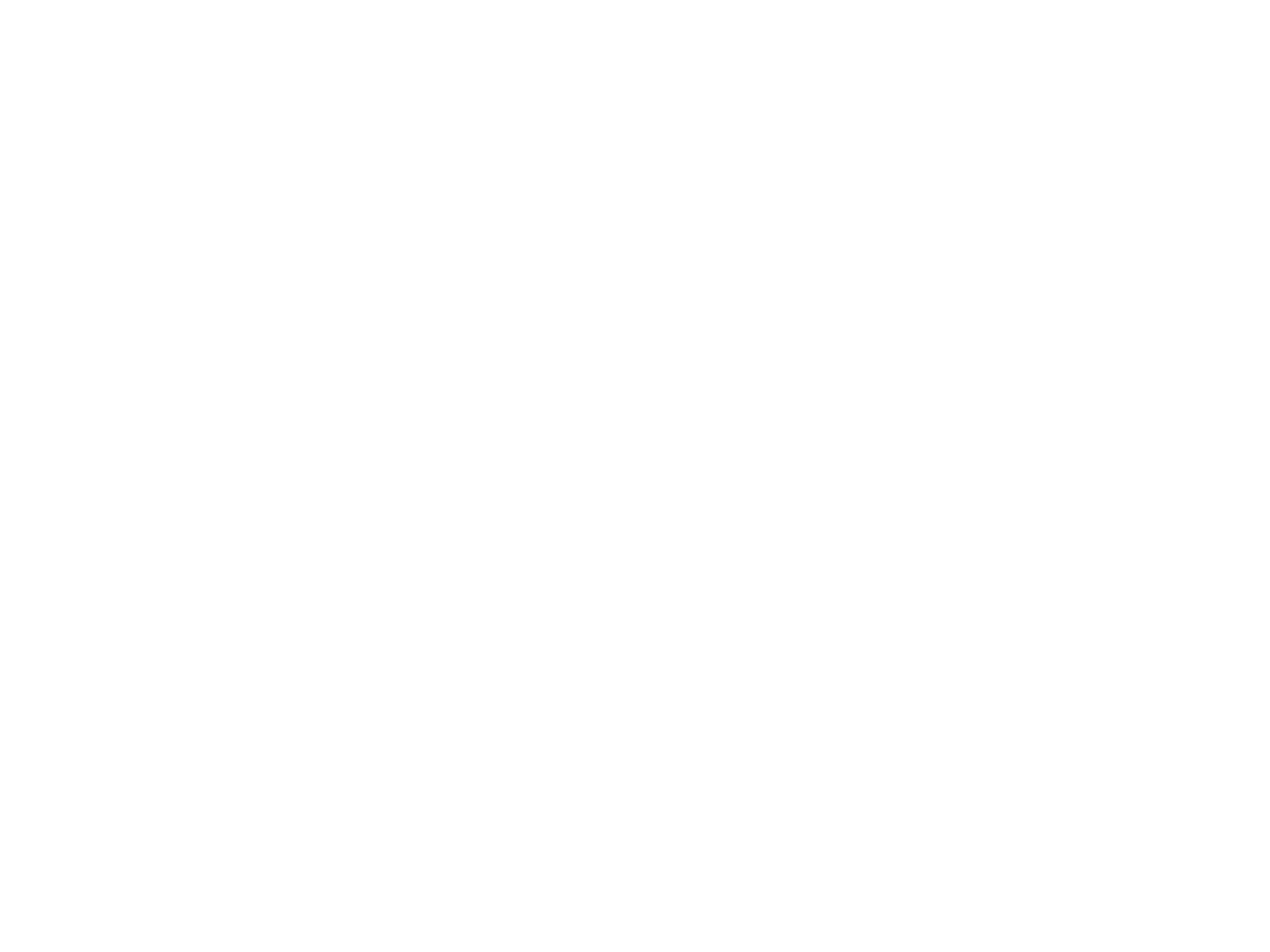
Habitatabhängigkeit bezieht sich auf die Notwendigkeit bestimmter Arten, auf bestimmte Lebensräume angewiesen zu sein, um zu überleben, sich zu ernähren, sich fortzupflanzen und ihren Lebenszyklus zu vollenden. Teiche sind wichtige Lebensräume für unzählige Arten, wie Amphibien, Wasserinsekten und Pflanzen, die an feuchte Umgebungen angepasst sind. Die Zerstörung oder Verschlechterung dieser Lebensräume, die durch den Klimawandel noch verschärft wird, bedroht diese Arten direkt. Für Salamander sind Teiche unverzichtbare Lebensräume, die geeignete Bedingungen für ihre Fortpflanzung bieten.
Interspezifische Beziehungen sind Interaktionen zwischen verschiedenen Arten innerhalb eines Ökosystems. In Teichen gehören dazu Raubtierverhalten, bei dem Salamander Wasserinsekten wie Mückenlarven und kleine Krebstiere jagen, Parasitismus, bei dem Blutegel sich an Amphibien festsaugen und sich von deren Blut ernähren, sowie Mutualismus, bei dem Bakterien auf der Haut der Salamander diese vor Pilzinfektionen schützen.
Diese Wechselwirkungen tragen zur Aufrechterhaltung des ökologischen Gleichgewichts bei, indem sie die Verfügbarkeit von Nahrung und die Populationskontrolle sicherstellen. Die Zerstörung von Lebensräumen und der Klimawandel können jedoch diese empfindlichen Beziehungen stören, wodurch die Artenvielfalt verringert und Arten bedroht werden, deren Überleben von Teichökosystemen abhängt.
SCHUTZSTATUS
Teiche sind Lebensräume mit hoher Artenvielfalt, die für unzählige Arten, insbesondere Amphibien, Insekten und Wasserpflanzen, von entscheidender Bedeutung sind. In Europa verschwinden diese Ökosysteme in alarmierendem Tempo. Studien schätzen, dass im letzten Jahrhundert bis zu 50 % der kleinen Feuchtgebiete aufgrund von Urbanisierung, Ausweitung der Landwirtschaft und Klimawandel verloren gegangen sind. Die Urbanisierung ist besonders schädlich, da sie zur Fragmentierung von Lebensräumen, zur Verschmutzung durch Abwässer und Chemikalien sowie zur Zerstörung von Brutplätzen führt. Für Amphibien wie Salamander stört der Verlust von Teichen ihren Fortpflanzungszyklus und führt zu einem Rückgang der Populationen. In Portugal sind viele Teiche temporär und sehr anfällig für sinkende Niederschlagsmengen und steigende Temperaturen, die beide durch den Klimawandel verstärkt werden. Die Intensivierung der Landwirtschaft bedroht diese Lebensräume zusätzlich durch Pestizidabfluss, übermäßige Wasserentnahme und Bodenerosion, wodurch die Wasserqualität verschlechtert und geeignete Brutplätze reduziert werden. Trotz ihrer ökologischen Bedeutung genießen Teiche oft nicht denselben Schutz wie andere Ökosysteme. Einige sind jedoch durch das Natura-2000-Netzwerk geschützt, das Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung umfasst, wie beispielsweise temporäre Teiche im Mittelmeerraum. Diese Lebensräume werden in der Habitat-Richtlinie der Europäischen Union aufgrund ihrer Seltenheit, Fragilität und Bedeutung für endemische Arten als vorrangig eingestuft.
Teiche sind Lebensräume mit hoher Artenvielfalt, die für unzählige Arten, insbesondere Amphibien, Insekten und Wasserpflanzen, von entscheidender Bedeutung sind. In Europa verschwinden diese Ökosysteme in alarmierendem Tempo. Studien schätzen, dass im letzten Jahrhundert bis zu 50 % der kleinen Feuchtgebiete aufgrund von Urbanisierung, Ausweitung der Landwirtschaft und Klimawandel verloren gegangen sind. Die Urbanisierung ist besonders schädlich, da sie zur Fragmentierung von Lebensräumen, zur Verschmutzung durch Abwässer und Chemikalien sowie zur Zerstörung von Brutplätzen führt. Für Amphibien wie Salamander stört der Verlust von Teichen ihren Fortpflanzungszyklus und führt zu einem Rückgang der Populationen. In Portugal sind viele Teiche temporär und sehr anfällig für sinkende Niederschlagsmengen und steigende Temperaturen, die beide durch den Klimawandel verstärkt werden. Die Intensivierung der Landwirtschaft bedroht diese Lebensräume zusätzlich durch Pestizidabfluss, übermäßige Wasserentnahme und Bodenerosion, wodurch die Wasserqualität verschlechtert und geeignete Brutplätze reduziert werden. Trotz ihrer ökologischen Bedeutung genießen Teiche oft nicht denselben Schutz wie andere Ökosysteme. Einige sind jedoch durch das Natura-2000-Netzwerk geschützt, das Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung umfasst, wie beispielsweise temporäre Teiche im Mittelmeerraum. Diese Lebensräume werden in der Habitat-Richtlinie der Europäischen Union aufgrund ihrer Seltenheit, Fragilität und Bedeutung für endemische Arten als vorrangig eingestuft.
