LIFE FOR BIODIVERSITY
Auswirkungen menschlicher Aktivitäten auf den Erhalt der biologischen Vielfalt
Die biologische Vielfalt umfasst die Vielfalt der Pflanzen, Tiere, Mikroorganismen, Lebensräume, Ökosysteme und genetischen Merkmale innerhalb der Arten, einschließlich Rassen und Kulturvarietäten. Schätzungen zufolge gibt es weltweit 10 bis 100 Millionen Arten, von denen bisher nur etwa 1,7 Millionen erforscht wurden. Menschliche Aktivitäten haben die biologische Vielfalt in den letzten Jahren erheblich bedroht und verringert.
Die biologische Vielfalt ist ein wertvolles Naturerbe und eine unverzichtbare Grundlage für das Leben der Menschen. Sie spielt eine entscheidende Rolle für die Prozesse in Ökosystemen und deren Anpassung an sich verändernde Bedingungen, insbesondere im Zusammenhang mit dem Klimawandel. Eine größere Arten- und genetische Vielfalt verbessert die Anpassungsfähigkeit an Umweltveränderungen. Darüber hinaus kann nur eine unberührte Natur vor Überschwemmungen und Bodenerosion schützen und liefert wichtige Produkte wie Nahrungsmittel, Baumaterialien und Inhaltsstoffe für Medikamente.
Österreich ist dank seiner geografischen Vielfalt eines der artenreichsten Länder Europas mit etwa 67.000 Arten, darunter 45.000 Tierarten und 3.000 Farn- und Blütenpflanzenarten. In ganz Europa gibt es schätzungsweise 200.000 Tier- und Pflanzenarten.
Die biologische Vielfalt in Österreich wird stark durch Landnutzung, Industrialisierung, Infrastrukturentwicklung, Lebensraumzerstörung, Klimawandel und Lichtemissionen beeinflusst. Ähnliche Probleme bestehen in der gesamten EU, wo viele Feuchtgebiete und zahlreiche Tierarten bedroht sind.
Die biologische Vielfalt ist ein wertvolles Naturerbe und eine unverzichtbare Grundlage für das Leben der Menschen. Sie spielt eine entscheidende Rolle für die Prozesse in Ökosystemen und deren Anpassung an sich verändernde Bedingungen, insbesondere im Zusammenhang mit dem Klimawandel. Eine größere Arten- und genetische Vielfalt verbessert die Anpassungsfähigkeit an Umweltveränderungen. Darüber hinaus kann nur eine unberührte Natur vor Überschwemmungen und Bodenerosion schützen und liefert wichtige Produkte wie Nahrungsmittel, Baumaterialien und Inhaltsstoffe für Medikamente.
Österreich ist dank seiner geografischen Vielfalt eines der artenreichsten Länder Europas mit etwa 67.000 Arten, darunter 45.000 Tierarten und 3.000 Farn- und Blütenpflanzenarten. In ganz Europa gibt es schätzungsweise 200.000 Tier- und Pflanzenarten.
Die biologische Vielfalt in Österreich wird stark durch Landnutzung, Industrialisierung, Infrastrukturentwicklung, Lebensraumzerstörung, Klimawandel und Lichtemissionen beeinflusst. Ähnliche Probleme bestehen in der gesamten EU, wo viele Feuchtgebiete und zahlreiche Tierarten bedroht sind.
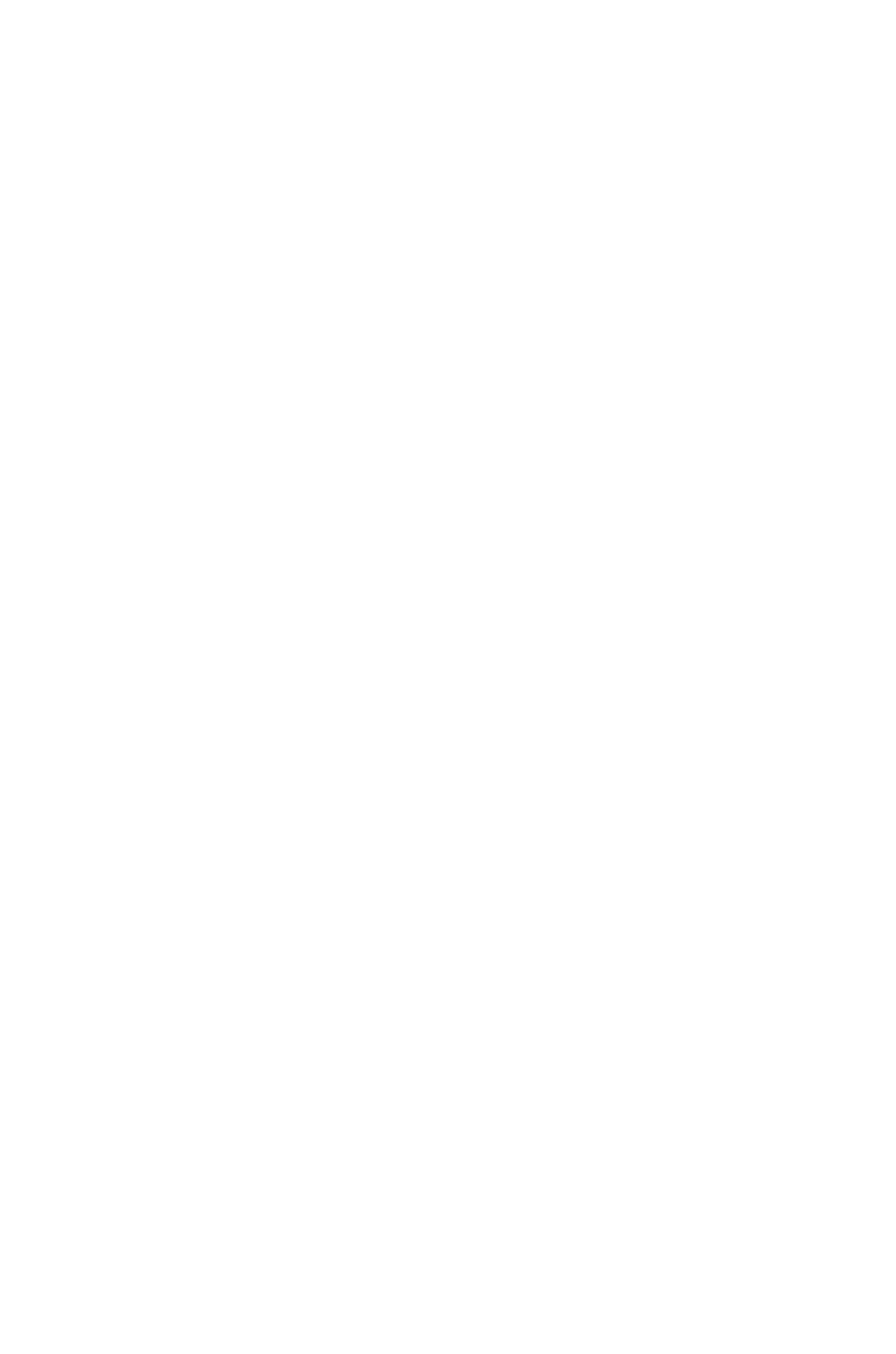
Wildbienen
Wildbienen gehören wie Honigbienen zur Insektenordnung der Hymenoptera und zur Familie der Apidae. Sie leben meist einzeln, nur Hummeln und einige Schweißbienen sind sozial. Wildbienen bevorzugen warme und trockene Bedingungen.
Die Fortpflanzung der einzelgängerischen Wildbienen erfolgt durch das Weibchen, das während seiner vier- bis achtwöchigen Flugzeit allein 4 bis 30 Brutkammern baut und versorgt. Etwa 30 % der Wildbienen sind auf den Pollen bestimmter Pflanzen angewiesen, was als oligolektisch bezeichnet wird. Die meisten Wildbienen leben einzeln, während einige, wie z. B. Kuckucksbienen, parasitär leben und ihre Larven in die Nester anderer einschleusen. Sie spielen eine entscheidende Rolle als Bestäuber für Wildpflanzen, Obstbäume und Nutzpflanzen und tragen so zur Artenvielfalt bei. Wildbienen ernähren sich von Nektar und Pollen, wobei viele Arten auf den Pollen bestimmter Pflanzen angewiesen sind.
Die Fortpflanzung der einzelgängerischen Wildbienen erfolgt durch das Weibchen, das während seiner vier- bis achtwöchigen Flugzeit allein 4 bis 30 Brutkammern baut und versorgt. Etwa 30 % der Wildbienen sind auf den Pollen bestimmter Pflanzen angewiesen, was als oligolektisch bezeichnet wird. Die meisten Wildbienen leben einzeln, während einige, wie z. B. Kuckucksbienen, parasitär leben und ihre Larven in die Nester anderer einschleusen. Sie spielen eine entscheidende Rolle als Bestäuber für Wildpflanzen, Obstbäume und Nutzpflanzen und tragen so zur Artenvielfalt bei. Wildbienen ernähren sich von Nektar und Pollen, wobei viele Arten auf den Pollen bestimmter Pflanzen angewiesen sind.
Europaweit Viren sind unter Bienen weit verbreitet, aber ihr Vorkommen und ihre Wechselwirkungen, insbesondere zwischen Honigbienen und Wildbienen, sind noch weitgehend unverstanden. Die gemeinsame Nutzung von Blütenressourcen verbindet Bienenarten in einem Netzwerk, das eine Virusübertragung in alle Richtungen ermöglicht.
Bei Honigbienen, Hummeln und Solitärbienen wurde das Vorhandensein von drei Viren nachgewiesen, wobei das Deformed Wing Virus am weitesten verbreitet war. Es wurden geografische Unterschiede in der Virusverteilung beobachtet, die nicht allein auf klimatische Bedingungen zurückgeführt werden konnten.
Eine hohe Virusprävalenz bei Honigbienen könnte auch Wildbienen beeinträchtigen. Darüber hinaus ist zu erwarten, dass der Klimawandel mit seinen Extremen das Auftreten von Viren bei Wildbienen beeinflussen wird, insbesondere in Gebieten mit extremen Temperaturen und Niederschlägen.
SCHUTZSTATUS
Wildbienen: Schlüssel zur Bestäubung und Artenvielfalt
Wildbienen sind für die Bestäubung, die Pflanzenvielfalt und die Biodiversität unverzichtbar. Sie fördern die Samen- und Fruchtproduktion und sichern die Nahrungsquellen. Ihr Rückgang bedroht die Ernährungssicherheit und die Biodiversität.
Bedrohung durch menschliche Einflüsse
Klimawandel, Lebensraumverlust, Monokulturen, Pestizide und Bienenzucht gefährden Wildbienen, Pflanzenwelt und Nahrungsversorgung. Da die Flugentfernungen zwischen ihren Nestern und Nahrungsquellen kürzer sind als bei Honigbienen, sind sie besonders anfällig für Umweltveränderungen. Bis zu 68 % der Arten in Mitteleuropa sind bedroht.
Notwendige Gewohnheiten
Wildbienen brauchen Nistplätze, Nahrung und Baumaterialien, natürliche Strukturen wie offenen Boden, Trockenmauern und Pflanzenstängel.
Förderung durch einfache Maßnahmen
Blumenwiesen, Natursteinmauern und strukturierte Gärten mit Hecken, Blumenbeeten und Teichen schaffen Lebensräume. Die Wiederverwendung vorhandener Materialien und die Toleranz gegenüber „Unkraut“ tragen dazu bei, Nahrungsquellen zu erhalten.
Herausforderungen durch Landschaftsveränderungen
Intensive Landwirtschaft und Bodenversiegelung zerstören blütenreiche Lebensräume. Der Verlust von Sandwegen, Hecken und Totholzhalden führt zu einem Mangel an Nistplätzen und Nahrungsengpässen, insbesondere im Spätsommer.
Wettbewerb zwischen Wild- und Honigbienen
In Regionen mit wenigen Blüten verdrängen Honigbienen Wildbienen. Studien zeigen Konkurrenz um Nahrung, aber direkte Untersuchungen sind begrenzt.
Menschliche Verantwortung
Der Rückgang der Wildbienen ist auf den Verlust strukturreicher Lebensräume zurückzuführen, nicht nur der Honigbienen. Beide Arten leben in blumenreichen Gebieten nebeneinander. Städte und ländliche Regionen sind gleichermaßen betroffen. Laut der Roten Liste von 2011 sind 52,2 % der Bienenarten bedroht.
Die biologische Vielfalt umfasst die Vielfalt der Pflanzen, Tiere, Mikroorganismen, Lebensräume, Ökosysteme und genetischen Merkmale, einschließlich kultivierter und domestizierter Arten. Weltweit sind etwa 1,75 Millionen Arten wissenschaftlich erfasst, wobei die tatsächliche Zahl unbekannt ist und Schätzungen zwischen 2,5 und 30 Millionen Arten liegen.
Menschliche Aktivitäten haben die biologische Vielfalt in den letzten Jahren erheblich bedroht und verringert.
Die Biodiversität ist ein wertvolles Naturerbe und eine unverzichtbare Lebensgrundlage. Sie spielt eine entscheidende Rolle in Ökosystemprozessen und bei der Anpassung an Umweltveränderungen, insbesondere im Zusammenhang mit dem Klimawandel. Arten- und genetische Vielfalt erhöhen die Anpassungsfähigkeit. Darüber hinaus schützt eine intakte Natur vor Überschwemmungen und Bodenerosion und liefert lebenswichtige Ressourcen wie Nahrungsmittel, Baumaterialien und medizinische Substanzen.
Dank seiner geografischen Vielfalt ist Österreich mit geschätzten 68.000 Arten, darunter rund 54.000 Tierarten, eines der artenreichsten Länder Europas.
Laut Roten Listen sind mehr als die Hälfte aller Amphibien und Reptilien, fast die Hälfte aller Fische und ein Drittel aller Vögel und Säugetiere vom Aussterben bedroht.
Die Hauptursachen für den Verlust der biologischen Vielfalt in Österreich und der EU sind Landnutzungsänderungen, Industrialisierung, Infrastrukturentwicklung, Klimawandel und Lebensraumzerstörung.
Menschliche Aktivitäten haben die biologische Vielfalt in den letzten Jahren erheblich bedroht und verringert.
Die Biodiversität ist ein wertvolles Naturerbe und eine unverzichtbare Lebensgrundlage. Sie spielt eine entscheidende Rolle in Ökosystemprozessen und bei der Anpassung an Umweltveränderungen, insbesondere im Zusammenhang mit dem Klimawandel. Arten- und genetische Vielfalt erhöhen die Anpassungsfähigkeit. Darüber hinaus schützt eine intakte Natur vor Überschwemmungen und Bodenerosion und liefert lebenswichtige Ressourcen wie Nahrungsmittel, Baumaterialien und medizinische Substanzen.
Dank seiner geografischen Vielfalt ist Österreich mit geschätzten 68.000 Arten, darunter rund 54.000 Tierarten, eines der artenreichsten Länder Europas.
Laut Roten Listen sind mehr als die Hälfte aller Amphibien und Reptilien, fast die Hälfte aller Fische und ein Drittel aller Vögel und Säugetiere vom Aussterben bedroht.
Die Hauptursachen für den Verlust der biologischen Vielfalt in Österreich und der EU sind Landnutzungsänderungen, Industrialisierung, Infrastrukturentwicklung, Klimawandel und Lebensraumzerstörung.
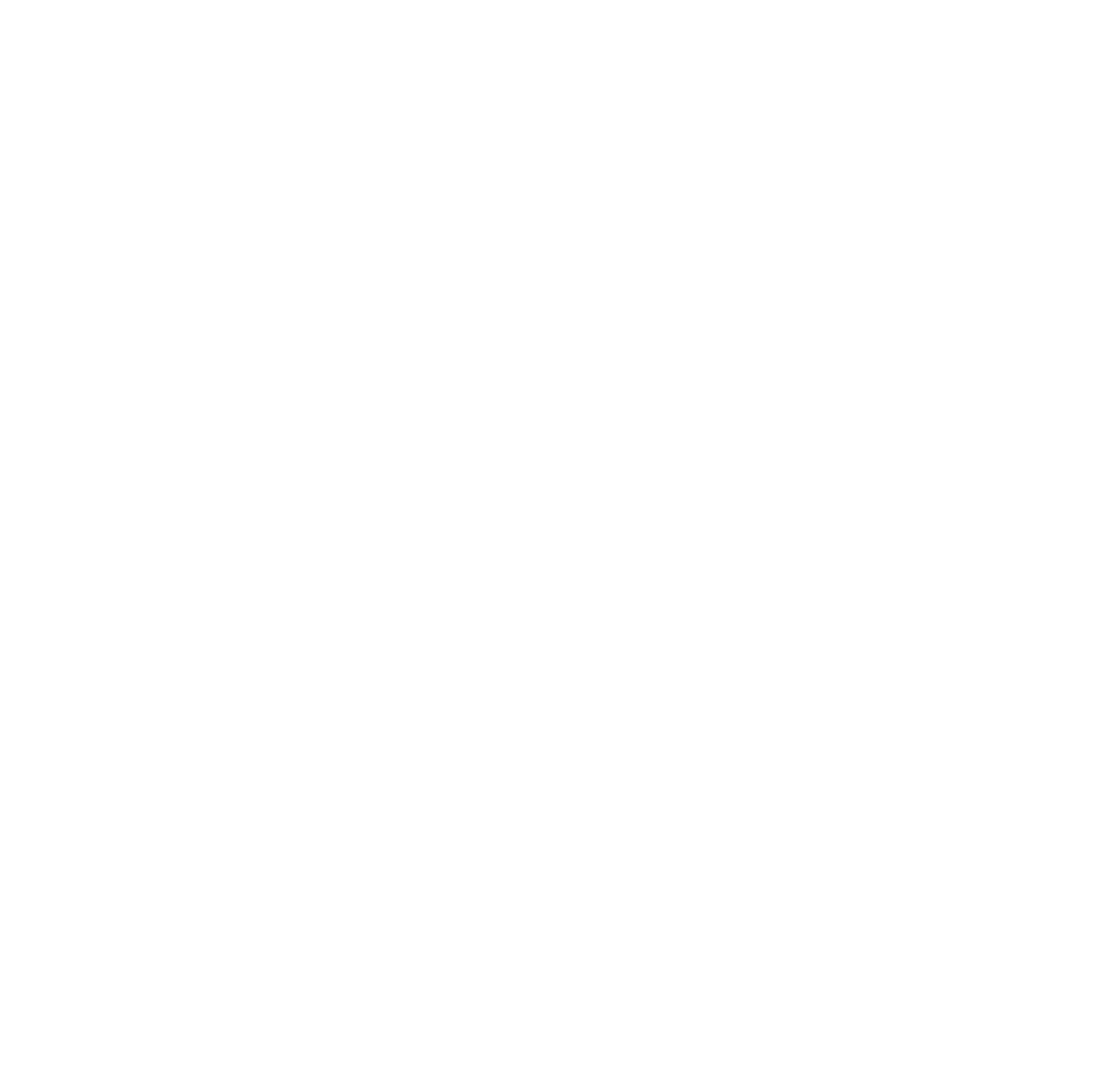
Fledermäuse
Fledermäuse brauchen miteinander verbundene Lebensräume: Quartiere, Jagdgebiete und Flugkorridore. Sie nutzen Kinderstubenquartiere zur Fortpflanzung, Winterquartiere, um Energieverlust zu vermeiden, und Schwarm- und Paarungsquartiere, um den genetischen Austausch sicherzustellen. Sie jagen in der Vegetation, auf Bauwerken oder im Luftraum; Feuchtgebiete und Wälder fördern ihre Vielfalt. Dunkle Flugkorridore sind für die Orientierung und Fitness unerlässlich.
Gegenseitigkeit
Fledermäuse interagieren mit verschiedenen Arten in unterschiedlichen interspezifischen Beziehungen:
In Europa ist die direkte Symbiose zwischen Fledermäusen und Pflanzen, insbesondere durch Bestäubung, weniger verbreitet als in tropischen Regionen. Einige Pflanzenarten, wie beispielsweise der Weißdorn (Crataegus monogyna), sind jedoch an die Bestäubung durch Fledermäuse angepasst.
In Europa ist die direkte Symbiose zwischen Fledermäusen und Pflanzen, insbesondere durch Bestäubung, weniger verbreitet als in tropischen Regionen. Einige Pflanzenarten, wie beispielsweise der Weißdorn (Crataegus monogyna), sind jedoch an die Bestäubung durch Fledermäuse angepasst.
Parasitismus
Fledermäuse beherbergen Ektoparasiten wie Fledermausfliegen und Flügelmilben, die sich von ihrem Blut ernähren und Krankheiten übertragen können. Diese Parasiten können zu Blutverlust, Infektionen und Verhaltensänderungen führen und das Immunsystem belasten. Jüngste Studien stellen jedoch in Frage, inwieweit Fledermäuse tatsächlich darunter leiden. Fledermäuse sind auch Träger von Viren, darunter Coronaviren, die auf Tiere oder Menschen übertragbar sind.
Kommensalismus
Einige Fledermäuse nisten in von Menschen erbauten Strukturen wie Gebäuden oder Brücken, ohne Menschen zu schaden. Das Verständnis solcher Beziehungen ist entscheidend für den Schutz der Fledermäuse und das ökologische Gleichgewicht.
SCHUTZSTATUS
Naturschutzorganisationen wie Bat Conservation International setzen sich dafür ein, die Bedrohung für Fledermäuse durch Forschung, Schutz ihrer Lebensräume und Aufklärung der Öffentlichkeit zu verringern. Sie überwachen Populationen, schützen wichtige Lebensräume und entwickeln Strategien zur Bekämpfung von Krankheiten wie dem WNS – White Nose Syndrom.
Verlust des Lebensraums
Die Zerstörung von Schlaf- und Futterplätzen, die häufig durch Urbanisierung und Entwaldung verursacht wird, stellt eine erhebliche Bedrohung dar.
Einsatz von Pestiziden
Der Einsatz von Pestiziden verringert die Verfügbarkeit von Insekten als Nahrungsquelle und kann zu Vergiftungen führen, was ein zusätzliches Risiko für die Fledermäuse darstellt.
Klimawandel
Klimaveränderungen wirken sich auf Insektenpopulationen und die Verfügbarkeit geeigneter Schlafplätze aus, was wiederum das Überleben der Fledermäuse beeinflusst. Fledermäuse reagierten sowohl positiv (z. B. Ausdehnung ihres Verbreitungsgebiets) als auch negativ (z. B. Rückgang der Population), wobei Extremereignisse stets zu negativen oder neutralen Reaktionen führten.
